Perlen der Literatur – „Unnützes“ Wissen - Essay - von Bertrand Russel
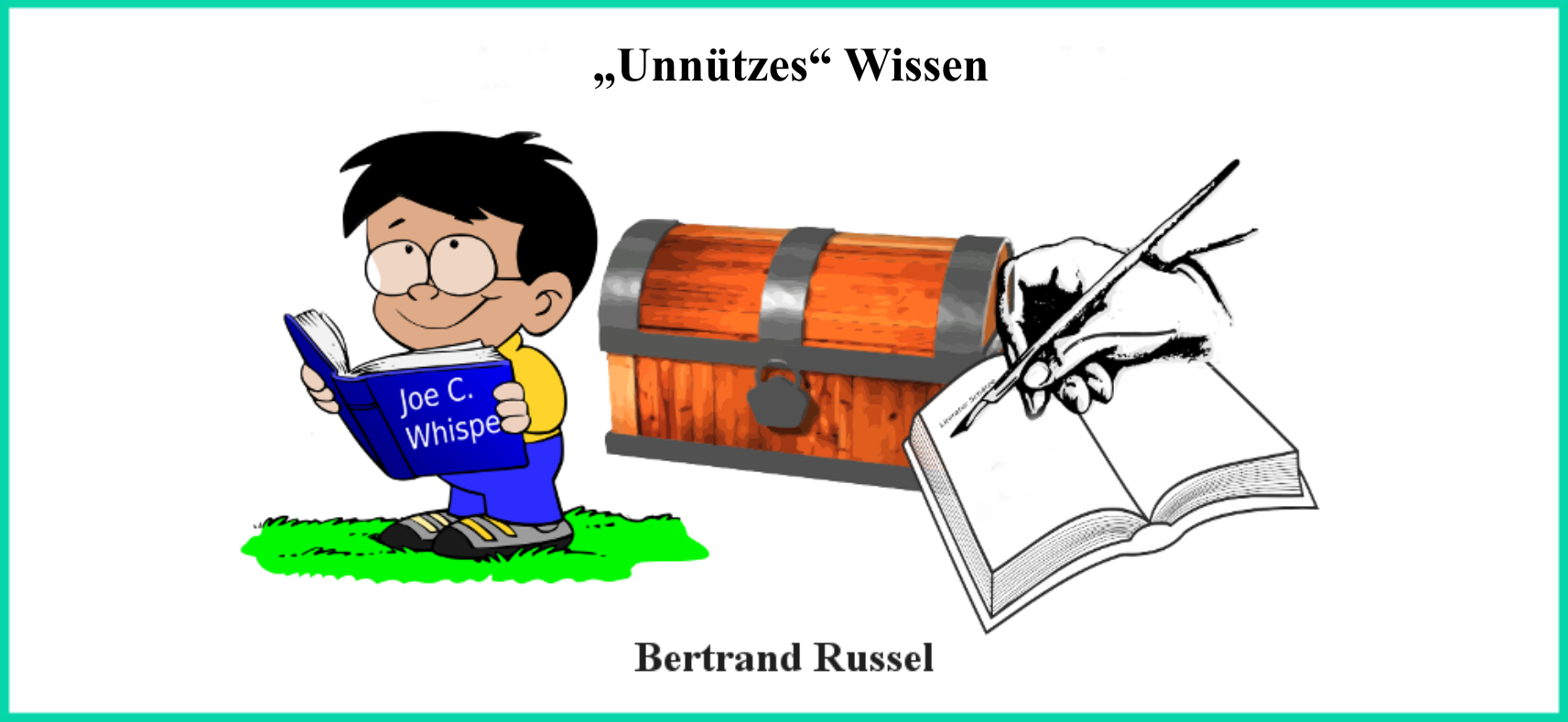
Werte Steemis,
aus der Reihe „Perlen der Literatur und nach literarisch, üppiger Kost, gibt es heute ein leicht verdauliches Essay von Bertrand Russel.
Gute Bücher und Schriften sind wie Austern, will man an die Perlen gelangen, muss man tief tauchen, Miesmuscheln hingegen, liest man am Strand auf.
Zu den Perlen der Literatur gehört sicher auch Bertrand Russels Buch „Lob des Müßiggangs“, das ihm 1950 den Nobelpreis für Literatur einbrachte. Aus diesem Buch möchte ich euch ein kurzes Essay vorstellen „Unnützes“ Wissen.
Meine einzige Kritik: Russel sollte in jedem guten Bücherregal zu finden sein, es ist nicht nur ein Vergnügen ihn zu lesen, seine überlegene Intelligenz, ist erschreckend schön.
Bertrand Russel
„Unnützes“ Wissen
Francis Bacon, ein Mann der durch Verrat an seinen Freuden zu Rang und Würden gelangte, behauptete – und stützt sich mit dieser weisen Lehre zweifellos auf eigene Erfahrung -, „Wissen ist Macht“. Das trifft aber nicht für jedes Wissen zu. Sir Thomas Browne hörte ebenfalls gerne das Gras wachsen und brachte es doch zu nichts, nicht einmal zum Obersheriff seiner Grafschaft. Was Bacon unter Wissen verstand, war das, was wir heute Naturwissenschaften nennen. Wenn er die Bedeutung der Wissenschaft nachdrücklich hervorhebt, so setzte er damit nachträglich die arabische und mittelalterliche Tradition fort, wonach Wissen hauptsächlich aus astrologischen, alchimistischen und pharmakologischen Kenntnissen bestand, die allesamt als Zweige der Wissenschaft galten. Gelehrt war, wer diese Studiengebiete beherrschte und dadurch magische Kräfte erlangt hatte. Im frühen 11. Jahrhundert hielt man Papst Silvester II. Allgemein für einen Schwarzkünstler, der mit dem Teufel im Bunde stand, und das nur, weil er Bücher las. Prospero, zu Shakespeares Zeiten eine reine Phantasiegestalt, verkörperte, was dann jahrhundertelang die allgemeine Auffassung von einem Gelehrten war, zumindest was seine Hexenkünste anging. Bacon glaubte – mit Recht, wie wir heute wissen -, die Wissenschaft könne zu einem mächtigen Zaubermittel werden als alle, was sich die Schwarzkünstler früherer Zeiten geträumt hätten.
Die Renaissance, die zur Zeit Bacons in England ihren Höhepunkt erreichte, brachte eine Revolte gegen die utilitaristische Auffassung von Wissen mit sich. Den Griechen war Homer so vertraut geworden wie uns unsere Schlager, weil seine Werke ihnen Freude machten und nicht, weil sie sich daran fortzubilden glaubten. Aber im sechzehnten Jahrhundert konnten die Menschen erst anfangen ihn zu verstehen, wenn sie sich beträchtliche Sprachkenntnisse angeeignet hatten. Sie bewunderten die Griechen und wünschten an ihren Freuden teilhaben zu können; deswegen ahmten sie nach, indem sie die Klassiker lasen, und noch auf andere, weniger lobenswerte Weise. Lernen und Wissen gehörte zur Zeit der Renaissance genau so zur Lebensfreude wie das Trinken und Hofmachen. Und das galt nicht nur für die Literatur, sondern auch für die strengeren Studiengebiete. Die Geschichte von Hobbes' erster Berührung mit Euklid ist ja allgemein bekannt; er schlug das Buch zufällig beim pythagoreischen Lehrsatz auf, rief aus: „Himmel, das ist ja unmöglich!“, begann dann die Beweise von hinten beginnend zu lesen, bis er, bei den Axiomen angelangt, überzeugt war. Bestimmt war das führ ihn ein beglückender und von keinem Gedanken an den Nutzen der Geometrie bei der Flächenberechnung getrübter Augenblick.
Zweifellos fand die Renaissance eine praktische Verwendungsmöglichkeit für die alten Sprachen in Verbindung mit der Theologie. Eines der ersten Ergebnisse der neuen Sympathie für das klassische Latein war die Diskreditierung der gefälschten Dekretalien und der Konstantinischen Schenkung. Auf Grund der Unstimmigkeiten, die man in der Vulgata und der Septuaginta entdeckte, wurden Griechisch und Hebräisch zum unentbehrlichen Rüstzeug der Geistlichen auf der gegnerischen protestantischen Seite. Man berief sich auf die republikanischen Maximen Griechenlands und Roms, um den Widerstand der Puritaner gegenüber den Status und der Jesuiten gegenüber den Fürsten zu rechtfertigen, die ihrer Lehnspflicht gegenüber dem Papst entsagt hatten. Aber all das war mehr Wirkung als Ursache der wiedererweckten klassischen Bildung, die in Italien fast ein Jahrhundert lang vor Luthers Zeit in Blüte gestanden hatte. Das Hauptmotiv der Renaissance war Freude am Geistigen, das neue Aufleben einer fruchtbaren Freizügigkeit auf künstlerischem und geistigem Gebiet, die verlorengegangen war, solange Unwissen und Aberglaube die geistige Sicht mit Scheuklappen eingeengt hatten.
Man erkannte, dass die Griechen auch Gegenständen ihre Aufmerksamkeit zugewandt hatten, die nicht rein literarischer oder künstlerischer Art waren, wie Philosophie, Geometrie und Astronomie. Das waren daher achtbare Studiengebiete, während andere Wissenschaften als verdächtig und zweifelhaft galten. Die Medizin wurde allerdings durch Namen wie Hippokrates und Galen geadelt; aber in der Zwischenzeit blieb sie fast ganz den Arabern und Juden überlassen und unauflöslich mit Magie verbunden. Daher der zweifelhafte Ruf von Männern wie Paracelsus. Die Chemie stand in noch schlechterem Ansehen und wurde erst knapp mit dem achtzehnten Jahrhundert zu einer respektablen Wissenschaft.
So kam es, dass griechische und lateinische Kenntnisse, mit einem Schuss Geometrie und vielleicht noch Astronomie, für das geistige Rüstzeug eines Gentleman gehalten wurden. Die Griechen verschmähten es, die Geometrie praktisch anzuwenden, und für die Astronomie fanden sie erst zur Zeit ihrer Dekadenz in der Tarnung der Astrologie Verwendung. Im sechzehnten und siebzehnten Jahrhundert vor allem studierte man Mathematik mit hellenistischer Objektivität und vernachlässigte meist jene Wissenschaften, die durch Verbindung mit Magie entwürdigt waren. Der allmähliche Übergang zu einer weniger begrenzten und praktischen Auffassung vom Wissen, der sich während des ganzen achtzehnten Jahrhunderts vollzog, erhielt am Ende dieser Periode einen plötzlichen, beschleunigten Antrieb durch die Französische Revolution und die Entwicklung des Maschinenwesens, wobei die erste der gentlemanliken Kultur einen Schlag versetze, indes die letztere der ungentlemanliken Handfertigkeit ein neues und überraschendes Tätigkeitsfeld eröffnete. Während der letzten hundertfünfzig Jahre haben die Menschen immer nachdrücklicher den Wert des „unnützen“ Wissens angezweifelt und sind immer mehr zu der Überzeugung gekommen, dass nur jenes Wissen lohnend sei, das sich auf irgendeinem Gebiet des allgemeinen Wirtschaftslebens nutzbringend anwenden lässt.
In Ländern wie Frankreich und England mit all ihren traditionellen Erziehungs- und Bildungssystems hat sich die utilitaristische Auffassung vom Wissen nur teilweise durchsetzen können. Da gibt es beispielsweise an den Universitäten noch Professoren, die Chinesisch lehren und die chinesischen Klassiker lesen, aber die Werke Sun- Yat-sens, des Schöpfers des heutigen China, nicht kennen. Da gibt es noch immer Männer, die in der antiken Geschichte zu Hause sind, soweit sie von Autoren reinen Sprachstils übermittelt ist, das heißt, in Griechenland bis zu Alexander und in Rom bis zu Nero; von der weit wichtigeren jüngeren Geschichte wollen sie jedoch nichts wissen, weil die entsprechenden Historiker sie literarisch zu minderwertig darstellen. Selbst in Frankreich und England ist jedoch die alte Tradition am Aussterben, und in modernen Staaten wie Russland und den vereinigten Staaten ist sie bereits völlig erloschen. In Amerika weisen beispielsweise pädagogische Kommissionen darauf hin, dass die meisten Leute in ihrer Geschäftskorrespondenz höchstens fünfzehnhundert Wörter gebrauchen, und empfehlen daher, alle übrigen Worte aus dem Schulunterricht auszumerzen. Das Basic-English, eine englische Erfindung, geht sogar noch weiter und beschränkt den notwendigen Sprachschatz auf achthundert Worte. Die Auffassung, dass die Sprache auch ästhetischen Wert haben könnte, stirbt aus; stattdessen kommt man zu der Überzeugung, Worte hätten den einzigen Zweck, nützliche Informationen zu übermitteln. In Russland werden die praktischen Ziele noch konsequenter verfolgt als in Amerika: was immer an Bildungsanstalten gelehrt wird, soll einem offensichtlich erzieherischen oder staatspolitischen Zweck dienen. Die einzige Ausnahme beansprucht die Theologie: die heiligen Schriften müssen im deutschen Original studiert werden, und einige Professoren müssen sich auch philosophische Kenntnisse aneignen, um den dialektischen Materialismus gegen die Kritik der bourgeoisen Metaphysiker verteidigen zu können. Wenn jedoch erst der orthodoxe Marxismus in Russland stärker verwurzelt ist, wird auch noch diese schmale Hintertür vermauert werden.
Allenthalben beginnt man, im Wissen nicht mehr den Eigenwert oder einen Weg zu weltweiter und menschlicher Lebensauffassung im allgemeinen zu sehen, sondern vielmehr sondern ein reines Ingrediens für technische Vervollkommnung. Das gehört zu der stärkeren gesellschaftlichen Integration, wie sie durch die naturwissenschaftliche Technik und die Kriegsgefahr entstanden ist. Wir haben heute größere wirtschaftliche und politische Verflechtungen als in früherer Zeit, und daraus ergibt sich auch eine stärkere soziale Forderung, die den Menschen zwingt, so zu leben, wie es seine Nächsten für nützlich halten. Alle Bildungsanstalten, mit Ausnahme der für die sehr Begüterten bestimmten, oder diejenigen (in England), die durch ehrwürdiges Alter vor Angriffen geschützt sind, dürfen ihr Geld nicht mehr nach belieben verwenden, sondern müssen vielmehr dem Staat die Gewissheit geben, dass sie einen nützlichen Zweck verfolgen, indem sie praktisches Wissen und Können sowie Loyalität lehren. Das gehört untrennbar zu eben jener Bewegung, die zur Militärdienstpflicht, zur Pfadfinderbewegung, zur Organisation der politischen Parteien und zur Aufhetzung der politischen Leidenschaft durch die Presse geführt hat. Wir alle sind uns heute unserer Mitbürger weit mehr bewusst als früher, mehr bestrebt, ihnen Gutes zu tun, wenn wir anständige Menschen sind, und in jedem falle bemüht, sie zu veranlassen, uns Gutes zu tun. Wir denken nicht gern an Leute, die sich eines müßigen Lebens erfreuen, selbst wenn diese Freunde unter dem edelsten und vollkommensten Vorzeichen stünde. Wir meinen, jeder sollte irgend etwas tun, um an der großen Sache mitzuarbeiten (was auch immer sie sei), um so mehr, als so viele schlechte Menschen dem entgegenwirken und daran gehindert werden sollten. Wir haben daher nicht mehr die geistige Muße, uns Wissen irgendwelcher Art anzueignen, abgesehen von solchen Kenntnissen, die uns beim Kampf für etwas, das wir zufällig für wichtig halten, unterstützen könnten.
Es lässt sich viel zugunsten der begrenzten utilitaristischen Auffassung von Erziehung und Bildung anführen. Die Zeit reicht nicht aus, alles zu lernen, bevor man anfangen muss, sich sein Brot zu verdienen, und zweifellos ist „nützliches“ Wissen sehr nützlich. Es hat die moderne Welt geschaffen. Ohne dieses Wissen hätten wir keine Maschinen und Autos und Eisenbahnen oder Flugzeuge; man sollte allerdings nicht vergessen, dass wir dann auch keine moderne Werbung und keine neuzeitliche Propaganda hätten. Dank dem modernen Wissen hat sich der durchschnittliche Gesundheitszustand der Menschheit ungeheuer gehoben; gleichzeitig haben wir entdeckt, wie man Großstädte mit Hilfe von Giftgas ausrotten kann. Was immer unsere heutige Welt im Vergleich zu vergangenen Zeiten auszeichnet, hat seine Wurzeln in „nützlichem“ Wissen. Aber keine Gemeinschaft besitzt es bisher im ausreichendem Maße, und zweifellos müssen Erziehung und Unterricht es weiterhin noch stark fördern.
Wir müssen ebenfalls einräumen, dass die traditionelle kulturelle Ausbildung zum großen Teil unsinnig war. Die jungen bemühten sich jahrelang, sich die lateinische und griechische Grammatik einzuprägen, ohne schließlich fähig zu sein oder den Wunsch zu empfinden (von einem kleinen Prozentsatz abgesehen), griechische oder lateinische Autoren zu lesen. Neue Sprachen und Geschichte sind in jeder Hinsicht dem Lateinischen und Griechischen vorzuziehen. Sie sind nicht nur nützlicher, sondern vermitteln auch in weit kürzerer Zeit weit mehr Kultur. Für einen Italiener des fünfzehnten Jahrhunderts war das Griechische oder lateinische der unentbehrliche Schlüssel zur Kultur, da praktisch alles lesenswerte, wenn nicht in seiner eigenen Sprache, griechisch oder lateinisch geschrieben war. Aber seit jener Zeit ist in verschiedenen Sprachen eine bedeutende Literatur entstanden, und die Zivilisation hat sich rasch entwickelt, dass die Kenntnis der Antike für das Verständnis unserer Probleme von viel geringerem Nutzen ist als die Kenntnis der modernen Völker und ihrer vergleichsweise nahe zurückliegenden Geschichte. Der traditionelle Schulmeister-Standpunkt, der wunderbar war zur Zeit der wieder auflebenden Gelehrsamkeit, wurde allmählich unangemessen eng und beschränkt, weil er unbeachtet ließ, was in der Welt seit dem fünfzehnten Jahrhundert vor sich gegangen ist. Und nicht nur Geschichte und neue Sprachen, sondern auch die Naturwissenschaft, wenn sie richtig gelehrt wird, trägt zur Kultur bei. Man kann sich daher durchaus dafür einsetzen, dass Erziehung und Unterricht neben dem unmittelbar Nützlichen auch noch andere Ziele verfolgen sollte, ohne damit die traditionelle Unterrichtsweise zu verteidigen. Wenn Nützlichkeit und Kultur liberal und umfassend aufgefasst werden, wird sich herausstellen, dass sie durchaus miteinander vereinbar sind, auch wenn es die fanatischen Vorkämpfer der einen wie der anderen Seite noch so heftig bestreiten.
Aber neben den Fällen, in denen sich kulturelle Bedeutung und unmittelbare Nützlichkeit vereinen lassen, hat der Besitz jenes Wissen, das nicht zur technischen Leistungsfähigkeit beiträgt, auch mittelbaren Nützlichkeitswert verschiedener Art. Ich glaube, einige der schlimmsten charakteristischen Merkmale der modernen Welt würden weniger stark hervortreten, wollte man dieses Wissen stärker fördern als das rücksichtslose Streben nach rein fachmännischem Können. Aus völliger Konzentration der ganzen bewussten Arbeitsleistung auf irgendeinem bestimmten Zweck, wird sich für die meisten Menschen letzten Endes Einseitigkeit, verbunden mit nervösen Störungen irgendwelcher Art, ergeben. Die Männer, die während des Krieges führend in der deutschen Politik waren, begingen Fehler, beispielsweise in der Führung des U-Boot-Krieges, auf Grund dessen sich Amerika den Alliierten anschloss; jedem, der sich unvoreingenommen und mit frischen Kräften mit dieser Frage beschäftigt hätte, wäre das unkluge daran aufgefallen; die führenden Männer aber konnten es gar nicht vernünftig bewerten, weil sie geistig nur darauf konzentriert waren und keine Zeit hatten, sich auch einmal zu erholen. Das gleiche kann man allenthalben beobachten, wo Menschen schwere Aufgaben zu erfüllen suchen, die bei fortgesetzter Anspannung die natürlichen Impulse hemmen. Wir finden bei den japanischen Imperialisten, den russischen Kommunisten und den deutschen Nazis durchweg einen gewissen übersteigerten Fanatismus, der sich daraus ergibt, dass sie allzu ausschließlich in der Vorstellungswelt leben, bestimmte Leistungen vollbringen zu müssen. Wenn die Aufgaben wirklich so bedeutend und durchführbar sind, wie die Fanatiker annehmen, kann diese Einstellung zu großenartigen Ergebnissen führen; in den meisten Fällen aber führt ihre Engstirnigkeit sie dazu, mächtige Widerstandskräfte nicht zu berücksichtigen oder all diese Kräfte für Teufelswerk zu halten, denen man mit Strafen und Terror entgegenwirken müsse. Erwachsene brauchen genau wie Kinder Zeit zu Erholung und Spiel, das heißt, Perioden, in denen sie nur tun, was der Freude und Unterhaltung des Augenblicks dient. Wenn aber dieser Zweck erfüllt werden soll, muss die Möglichkeit bestehen, dass die Menschen Vergnügen und Interesse an Dingen finden, die nicht mit Arbeit verbunden sind.
Der unterhaltende Zeitvertreib der modernen Stadtbewohner hat nun die Tendenz, immer passiver und kollektiver zu werden, und besteht hauptsächlich im untätigen Anschauen und Wahrnehmen der fachlichen Leistungen anderer Leute. Zweifellos ist diese Art von Unterhaltung immer noch besser als gar keine; doch wäre ein Zeitvertreib vorzuziehen, wie ihn sich Menschen schaffen würden, die dank Erziehung und Unterricht einen erweiterten, vernünftigen, nicht mit Arbeit verbundenen Interessenkreis haben. Eine bessere Wirtschaftsordnung, die es der Menschheit ermöglichen würde, echten Nutzen aus der Produktivität der Maschinen zu ziehen, könnte zu einem weit größeren Maß an Freizeit führen; aber viel Muße kann sehr leicht ermüdend wirken, wenn Menschen sich nicht in beträchtlichem Maße vernünftig und interessant zu beschäftigen verstehen. Wenn ein Volk sich bei viel Freizeit glücklich fühlen soll, muss es gebildet sein, und zwar herangebildet sowohl im Hinblick auf geistige Unterhaltung wie auf das unmittelbar nützliche technische Wissen.
Wenn sich die Menschen das kulturelle Element in Unterricht und Ausbildung mit Erfolg zu eigen machen, dann formt es den Charakter ihres Denkens und Strebens, veranlasst sie, sich zumindest teilweise mit großen, überpersönlichen Zielen zu beschäftigen und nicht nur mit Dingen, die von unmittelbarer Bedeutung für sie selbst sind. Man hat alles zu leichtfertig angenommen, dass der Mensch, der sich, auf wissenschaftliche Kenntnis gestützt, gewisse Fähigkeiten angeeignet hat, sie auch zum Nutzen der Allgemeinheit einsetzen wird. Die Erziehung in der beschränkten utilitaristischen Auffassung übersieht jedoch völlig, dass es nottut, neben den Fähigkeiten des Menschen auch seine geistige Zielstrebung höher zu entwickeln. In jedem unerzogenen Menschen steckt von Natur ein gut Teil Grausamkeit, das auf vielerlei Art, stark oder minder stark, zum Ausdruck kommt. Schulbuben pflegen einen Neuen oder einen Schüler, dessen Anzug vom jeweils Üblichen abweicht, zu ärgern. Viele Frauen (auch eine ganze Menge Männer) verursachen das größtmögliche Unheil durch böswilligen Klatsch. Die Spanier lieben Stierkämpfe, die Engländer Jagd und Schießerei. Die gleichen grausamen Impulse nehmen schwerwiegende Formen an in der Menschenjagd auf Juden in Deutschland und auf Kulaken in Russland. Jeder Imperialismus gewährt ihnen Spielraum, und im Krieg sanktioniert man sie als Ausdruck höchster staatsbürgerlicher Pflicht.
Aber wenn man auch zugeben muss, dass zuweilen auch hochgebildete Leute grausam sind, halte ich es doch für unbestreitbar, dass es bei ihnen seltener vorkommt als bei Menschen, die man hat geistig brachliegen lassen. Der Raufbold und Quälgeist einer Schule ist selten ein Junge, der im Unterricht überdurchschnittliches leistet. Wenn irgendwo Lynchjustiz geübt wird, sind Rädelsfüher fast ausnahmslos sehr ungebildete Leute. Das beruht nicht darauf, dass geistige Kultur positive menschenfreundliche Gefühle erzeugt, obwohl sie diesen Einfuß haben kann; vielmehr werden geistig kultivierte Menschen an anderen Dingen interessiert sein als an der Misshandlung ihrer Nächsten und ihre Selbstachtung aus anderen Quellen beziehen als aus gewaltsamer Bestätigung ihrer Herrschsucht. Macht und Bewunderung sind die beiden Dinge, die ganz allgemein am meisten angestrebt werden. Unwissende Menschen können beides in der Regel nur mit brutalen Mitteln erreichen, was überlegende Körperkraft und Gewandtheit voraussetzt. Kultur vermittelt den Menschen Macht in unschädlicherer Form und ermöglicht es ihnen, Bewunderung auf verdienstvolle Weise zu erringen. Galilei hat mehr dazu beigetragen, die Welt zu verwandeln, als alle Monarchen, und an Macht war er seinen Verfolgern turmhoch überlegen. Er brauchte daher nicht danach zu trachten, seinerseits zum Verfolger zu werden.
Der wesentliche Vorteil des „unnützen“ Wissens besteht aber vielleicht darin, dass es zum Nachdenken anregt und eine kontemplative geistige Einstellung fördert. Die Welt ist allgemein nur allzu leicht bereit, nicht nur zu handeln, ohne zuvor gebührend nachgedacht zu haben, sondern auch gelegentlich da zu handeln, wo es klüger wäre, auf das Handeln zu verzichten. Diese Neigung der Menschen zeigt sich auf verschiedene merkwürdige Weise. Mephistopheles redet dem jungen Schüler ein, dass alle Theorie grau sei, doch grün des Lebens goldner Baum, und jedermann zitiert das, als sei es Goethes eigene Meinung und nicht das, was nach seiner Auffassung der Teufel wohl einem Studenten sagen würde. Hamlet wird als abschreckendes Beispiel eines Menschen hingestellt, der denkt, ohne zu handeln, aber niemand sieht in Othello eine Warnung vor dem Menschen, der handelt, ohne zu denken. Professoren wie Bergson verleumden aus einer gewissen Versnobtheit gegenüber dem werktätigen Mann die Philosophie und erklären, das Leben sollte, um sich zu erfüllen, einer Kavallerieattacke gleichen. Ich für mein Teil halte Handeln dann für am besten, wenn es aus einer tiefen Erkenntnis des Universums und der menschlichen Bestimmung hervorgeht, nicht aus einem ungezähmten leidenschaftlichen Impuls romantischer, aber unberechtigter Selbstherrlichkeit. Wenn es zur Gewohnheit wird, mehr Freude an der Ideenwelt als an der Aktion zu finden, so schützt uns das vor Unklugheit und übertriebener Machtgier; zugleich ist es ein Mittel, sich im Unglück Gelassenheit und in Zeiten der Plage Seelenfrieden zu bewahren. Ein auf alles Persönliche beschränktes Leben wird wahrscheinlich früher oder später zum unerträglichen Leidensweg werden; nur die Ausblicke auf einen größeren, allen Irdischen übergeordneten Kosmos helfen uns, die tragischen Momente unseres Lebens zu ertragen.
Die Vorteile einer kontemplativen geistigen Einstellung reichen vom Trivialsten bis zum Tiefsten. Beginnen wir einmal bei den kleinen alltäglichen Ärgernissen wie Flöhen, verpassten Zügen oder händelsüchtigen Teilhabern. Solche Schwierigkeiten scheinen es kaum zu rechtfertigen, dass man sich ihrer mit Betrachtungen über die Vorzüge einer heroischen Haltung oder Vergänglichkeit aller menschlichen Leiden erwehrt, und doch lassen sich viele Leute dadurch so erregen und reizen, dass sie ihre gute Laune und Lebensfreude einbüßen. Bei solchen Gelegenheiten wirkt ein wenig Spezialwissen, das in echtem oder vermeintlichem Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Ärgernis steht, sehr tröstlich; aber selbst wenn ein solcher Zusammenhang nicht besteht, lenkt es die Gedanken vom Augenblick ab. Wenn man von Leuten angegriffen wird, die weiß vor Wut sind, ist es amüsant, sich das Kapitel in Descartes' Traktat über Leidenschaften ins Gedächtnis zu rufen, das den Titel trägt: „Warum man Leute die vor Wut blass werden, mehr fürchten muss, als jene die rot werden“. Wird man einmal ungeduldig, weil es so schwierig ist, zu internationaler Zusammenarbeit zu kommen, dann legt sich diese Ungeduld etwas bei dem Gedanken an Ludwig IX. Den Heiligen, der sich vor dem Aufbruch zu einem Kreuzzug mit dem Alten vom Berge verbündete, der in „Tausend und einer Nacht“ als der dunkle Ursprung fast alles Bösen in der Welt erscheint. Wenn die Habgier der Kapitalisten überhandnimmt, ist man vielleicht schnell getröstet, wenn man sich erinnert, das Brutus, dieses Musterexemplar republikanischer Tugend, einer Stadt Geld zu vierzig Prozent lieh und dann eine Privatarmee erwarb, um diese Stadt zu belagern, als sie die Zinsen nicht bezahlen konnte.
Durch das Wissen um merkwürdige Dinge wird alles Uninteressante reizvoller und alles Erfreuliche noch erfreulicher. Ich habe von Aprikosen und Pfirsichen mehr Genuss gehabt, seit ich wusste, dass sie zum erstenmal in China zu Beginn der Han-Dynastie gezüchtet wurden: dass chinesische Geiseln, die der große König Kaninska gefangenhielt, sie nach Indinen einführten, von wo aus sie sich nach Persien ausbreiteten und das römische Reich im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung erreichten; dass das Wort „Aprikose“ vom gleichen lateinischen Stamm abgeleitet ist wie das Wort praecox (frühreif), weil die Aprikose frühreif wird; und dass das A am Anfang irrtümlich auf Grund falscher Etymologie hinzugesetzt wurde. Daraufhin schmeckt die Frucht noch viel besser.
Vor etwa hundert Jahren riefen wohlmeinende Menschenfreunde Gesellschaften „zur Verbreitung nützlichen Wissens“ ins Leben, mit dem Erfolg, dass die Menschen den Geschmack an den Köstlichkeiten „unnützen“ Wissens verloren haben. Eines Tages, als ich schlechter Stimmung war, schlug ich auf gut Glück Burtons Anatomie der Melancholie auf und erfuhr, dass es eine „melancholische Streitfrage“ gibt; während einige glauben, die Melancholie werde von allen vier Temperamenten, „behauptet Galen, dass sie nur von drei erzeugt erden könne, unter Ausschluss der Tätigkeit oder Gleichgültigkeit; für die Wahrheit dieser Behauptung setzen sich stark ein Valerius und Menardus, desgleichen Fuscius, Montaltus, Montanus. Wie könnte, so sagen sie, aus weiß schwarz werden?“ Ungeachtet dieses unwiderleglichen Arguments sind, wie uns Burton verrät, Hercules von Sachsen und Cardan, Guianerius und Laurentius der entgegengesetzten Ansicht. Unter der besänftigenden Wirkung dieser historischen Betrachtungen war meine eigene Melancholie verflogen, sei sie nun auf drei oder vier Temperamente zurückzuführen gewesen. Ich kann mir kaum bessere Heilmittel für Übereifer vorstellen als das Studium solcher antiker Kontroversen.
Aber während die geringen Freuden der Kultur zum Trost für geringfügige Ärgernisse des praktischen Lebens gedacht sind, beziehen sich die bedeutenderen Verdienste der Kontemplation auf das größere Leid im Leben, auf Tod und Qual und Grausamkeit und das blinde Hineinrennen der Völker in unnötiges Unheil. Für diejenigen, denen die dogmatische Religion keinen Trost mehr bringt, bedarf es eines Ersatzes, wenn der Mensch nicht Anmaßend und das Leben nicht trübe und freudlos werden soll. Die Welt ist heute voll gereizter, egozentrischer Gruppen; sie alle sind unfähig, die Menschheit und ihr Leben als ein Ganzes zu sehen, und bereit lieber die Zivilisation zu Grunde zu richten, als auch nur im geringsten nachzugeben. Diese Engstirnigkeit kann auch die größte mögliche technische Ausbildung nicht angemessen entgegenwirken. Das Gegengift, soweit es Sache der individuellen Psychologie ist, muss in der Geschichte, Biologie und Astronomie gesucht werden, auf all jenen Studiengebieten also, die es dem einzelnen ermöglichen, sich im richtigen Verhältnis zum Universum zu sehen, ohne dass dadurch seine Selbstachtung leidet. Erforderlich ist nicht dieses oder jenes spezielle Teilwissen, sondern allgemeine Kenntnisse, de einen Begriff vom Sinn und Ziel des Menschenlebens als Ganzes vermitteln: Kunst und Geschichte, Vertrautheit mit dem Leben heroischer Persönlichkeiten und etwas Verständnis für die merkwürdig zufällige Eintags-Situation des Menschen im Kosmos – all das mit einem Anflug von Stolz auf das, was dem Menschen vorbehalten ist, die Kraft, zu sehen und zu wissen, selbstlos zu empfinden und vernünftig zu denken. Umfassendes Wahrnehmen und Erkennen, verbunden mit uneigennützigem Empfinden, sind er beste Nährboden für Weisheit.
Das Leben, zu allen Zeiten reich an Schmerz und Qual, ist heute noch qualvoller als in den vergangenen zwei Jahrhunderten. Die Menschen versuchen, der Pein und Sorge zu entrinnen, und werden dabei ins Wertlose, in den Selbstbetrug und in die Erfindung ungeheurer kollektiver Mythen hineingetrieben. Aber auf die Dauer tragen diese flüchtigen Linderungsmittel nur dazu bei, die Ursachen der Menschlichen Leiden noch zu verstärken. Privates und allgemeines Unglück ist allein durch einen Vorgang zu meistern, indem Energie und Klugheit zusammenwirken müssen: Aufgabe des Willens muss es sein, es abzulehnen, dem Übel auszuweichen oder eine unechte Lösung anzuerkennen; Aufgabe der Klugheit:, das Übel zu erkennen, ein Heilmittel zu finden, wenn es heilbar ist, und es anderenfalls erträglich zu machen, indem es im rechten Verhältnis gesehen wird, es als unumgänglich anzuerkennen und dessen zu gedenken, was noch darüber hinaus in anderen Religionen, anderen Zeitaltern und in den Tiefen der Sternenwelt ruht.
Quelle: http://find.nlc.cn/search/doSearch?query=bertrant%20russel&secQuery=&actualQuery=bertrant%20russel&searchType=2&docType=%E5%85%A8%E9%83%A8&isGroup=isGroup&targetFieldLog=%E5%85%A8%E9%83%A8%E5%AD%97%E6%AE%B5&fromHome=true
Quelle: http://www.nl.go.kr/nl/search/search.jsp?all=on&topF1=title_author&kwd=Bertrand+Russell
Quelle: https://search.rsl.ru/ru/search#q=bertrand%20russel
Joe C. Whisper